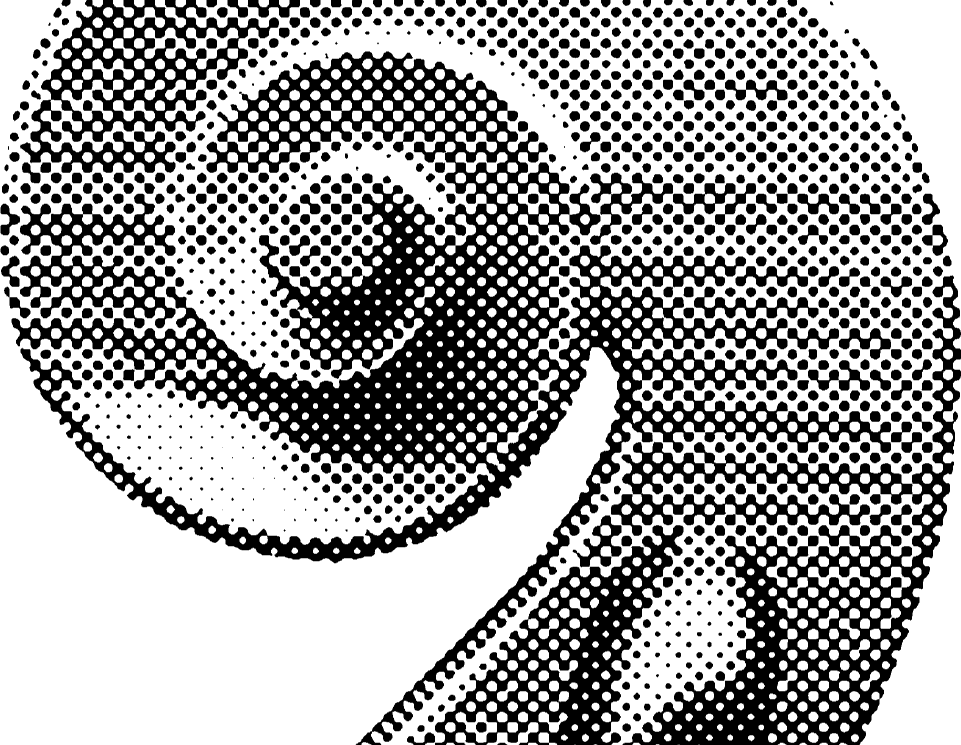Die Cellistin Marie-Elisabeth Hecker ist uns bei einer Schubertiade der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern wegen ihres natürlichen und beseelten Spiels aufgefallen (damals u.a. beim Schubert-Quintett zusammen mit dem Armida Quartett). Über das Cello sagt sie: „Für mich ist es das vielfältigste Instrument .... Man kann es sehr natürlich spielen, man muss sich dabei nicht verrenken.“ Den internationalen Durchbruch bescherte ihr der sensationelle Erfolg beim Rostropowitsch-Wettbewerb 2005 in Paris: Dort gewann sie – erstmals in der Geschichte dieses Cellowettbewerbes – sowohl den ersten Preis als auch zwei Sonderpreise. Regelmäßig musiziert sie mit Ihrem Ehemann Martin Helmchen, einem der gefragtesten Pianisten, der seit Jahrzehnten auf den wichtigsten Podien der Welt konzertiert. 2001 gewann er den Concours Clara Haskil. Eine reiche Diskographie hat er bereits vorgelegt mit hochgelobten und reichlich mit Preisen ausgezeichneten Aufnahmen, auch mit seiner Frau (und auch mit der Geigerin Alissa Margulis).
Im Gegensatz dazu setzt Dmitri Schostakowitsch in seiner frühen Sonate d-Moll op. 40 ganz auf die klassisch-romantische Formtradition. Doch blitzt immer wieder der „echte“ Schostakowitsch auf mit fahlen Pizzicati, hämmernden Ostinati und mechanischen Oktaven im Klavier. Eine Sonate von kantabler Schönheit aber auch von bitterem Sarkasmus, geschrieben 1934, noch bevor Schostakowitsch 1936 nach Stalins berüchtigtem Prawda-Artikel „Chaos statt Musik“ zum verfemten Komponisten wurde.
Noch ganz in der Tradition des 19. Jahrhunderts, in der Nachfolge von Chopin, Liszt und Tschaikowski steht Sergej Rachmaninows Cello-Sonate in g-Moll op. 19 aus dem Jahr 1901. Man hört eine klassisch viersätzige Sonate von ausufernder Melodienseligkeit mit schwelgerischen Cellokantilenen und virtuosen Klangfluten des Klaviers. Nicht um spiel- und satztechnische Neuerungen ging es dem Komponisten dabei, sondern um Erfolg beim Publikum – und der ist diesem schwärmerischen Werk bis heute treu geblieben.
Programmänderung
Aus persönlichen Gründen haben die Künstler das Programm geändert und spielen statt der Cellosonate von Rachmaninow die Cellosonate von Sergej Prokofjew. Prokofjew schrieb dieses Werk 1949 und widmete es dem großen russischen Cellisten Mstislav Rostropowitsch. Für den Komponisten war das eine Gradwanderung. Ihm war von der politischen Führung der Sowjetunion „Formalismus“ vorgeworfen worden. So schrieb er mit seiner Cellosonate ein gesangliches, durchaus eingängiges Werk – aber ohne sich selbst und seinen Stil zu verleugnen. „Es empfiehlt sich zwischen den Zeilen zu hören“ (Susanne Herzog).
Diese drei Werke der drei russischen Komponisten zeigen jeweils komplett unterschiedliche Stile in einem Zeitraum von knapp 20 Jahren.
BR-Klassik wird dieses Programm aufzeichnen und am 20.6.24 um 20.05 senden.
Marie-Elisabeth Hecker Violoncello
Martin Helmchen Klavier
- Igor Strawinsky
„Suite italienne“ für Cello und Klavier - Dmitri Schostakowitsch
Cellosonate d-Moll op. 40 - Sergej Prokofjew
Cellosonate C-Dur op. 119
Tickets sind hier erhältlich

BR-Klassik wird dieses Konzert aufzeichnen